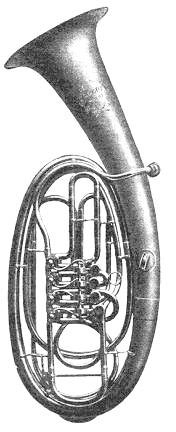Die Wagnertuba wurde von einigen Wagner-Erben aufgenommen, ihre Literatur und ihr Einfluss wuchsen immer mehr, eine annehmbare Zahl Hersteller produzierte sie nun und militärische Verträge versprachen eine erfolgreiche Zukunft. Der Erste Weltkrieg jedoch vertrieb die meisten Militärkapellen und mit ihnen auch die letzten Überreste der Romantik. Nun stellte sich die Frage, ob die Wagnertuba ihren Platz auch in der modernen Musiklandschaft finden würde? Würden “moderne” Komponisten die Instrumente überhaupt in Erwägung ziehen und wenn ja, wie?
Tatsächlich nutzten die modernen Titanen die Wagnertuba kaum. Schönbergs einziger Gebrauch des Instruments erfolgte in die „Gurre-Lieder” (1900-1911) und beinhaltete zehn Hörner in F, die letzten vier davon doppelten dabei die Wagnertuben (Tenortuben in Es und Basstuben in B, die einzige Abweichung dabei stellte die Sitzordnung dar: sieben und acht in B, und neun und zehn in F).
Strawinsky wurde schon früh von der Musik Wagners, Bruckners und Strauss beeinflusst, aber wohl eher nicht vom Einsatz der Wagnertuba selbst. Er setzte sie auf sehr einzigartige Weise in seinem eigenen Werk “Der Feuervogel” (1910) ein. “Die Frühlingsweihe” (1911-13) war Strawinskys zweite und letzte Arbeit für das Instrument. Er führte nicht an, welche Oktave er für die Teile der B-Tenortuba benötigte, darüber wird bis heute spekuliert.
Bela Bartok verwendete zwei B-Tenortuben in “Kossuth” (1903) und “Der wunderbare Mandarin” op. 19 (1918-19). In Gustav Holsts “Die Planeten” (1914-16) soll die Tenortuba in B von einem Euphonium gespielt werden, wird aber bei der Aufführung in Wien von der Wagnertuba besetzt. Leos Janaceks “Sokol Fanfare” aus seiner “Sinfonietta” und “Capriccio” (1926), deren Partituren Wagnertuben aufweisen, setzten ebenfalls Euphoniums in Prag und Wagnertuben in Wien ein!
Die Kompositionen für Wagnertuben gingen seit dem Ersten Weltkrieg immer mehr zurück und wurden über einen Zeitraum von 40 Jahren schmählich vernachlässigt. Ausnahmen bildeten dabei jedoch Stokowskis Orchesterfassung von Bachs „Passacaglia“ in c-Moll BWV 582, die ein Quartett von Tenor- und Basstuben verwendet, ebenso wie Vareses “Arcana” (1927). Die Solo-Tuba in Ravels Orchestrierung der “Bilder einer Ausstellung” (Bydlo) wird hin und wieder von einer Wagnertuba gespielt. Doch all das sind lediglich Gastauftritte.
Der dänische Komponist Rued Langaard (1893-1952) verwendete ein Quartett von Wagnertuben in seiner ersten Sinfonie (1908-11). Als das Werk in Berlin uraufgeführt wurde, wurden die Teile der Wagnertuba von Hörnern gespielt, um Geld zu sparen. Kein Wunder, dass Langaard seitdem nie wieder für Wagnertuben schrieb!
Mit Voranschreiten des Jahrhunderts gaben viele Hersteller ihr Geschäft auf. Sogar der älteste bis dahin erhaltene Instrumentenfabrikant, C.W. Moritz, schloss seinen Betrieb im Jahre 1955. Die Wagnertuba lief Gefahr, ein Museumsstück zu werden.
Als Nächstes: Das Revival der Wagnertuba